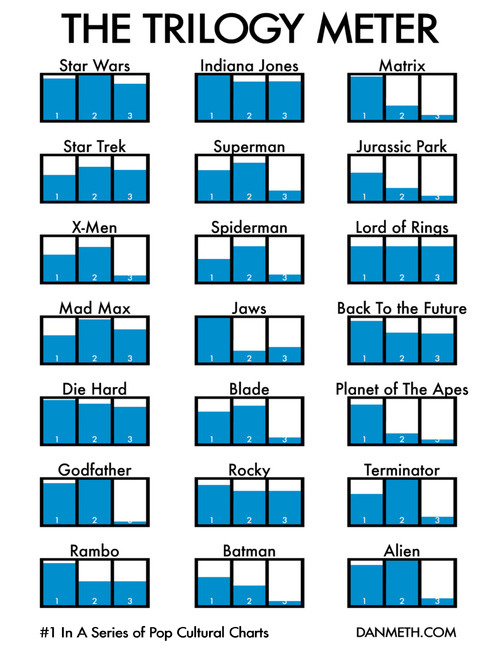1990 muss für die Politik ein Schock gewessen sein. Naja, zumindest hatte die Presse etwas zu schreiben.
Hatte Willi Brandt es noch geschafft, die Wahlbeteiligung auf einmalige 91,1 Prozent zu heben, brachte Helmut Kohl bei seiner zweiten Wahl trotz oder wegen der Wiedervereinigung nur 77,8 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne. Die Politiker hatten etwas zu grübeln, die Presse etwas zu schreiben und die Wissenschaft hatte ein spannendes neues Forschungsgebiet, die Nichtwähler – das unbekannte Wesen.
Wahlenthaltung als Form des Wahlverhaltens
Anzahl
Nichtwähler gibt es einige. Bei der letzten Bundestagswahl waren es ungefähr 14.000.000. Auf Länder umgegrechnet hieße das, das Bayern, das Saarland und Bremen quasi nicht an der Wahl teilgenommen hätten, oder alternativ ganz Norddeutschland (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen & Schleswig-Holstein).
Der Tübinger Wissenschaftler Michael Eilfort hat in einer Untersuchung festgestellt, dass der soziale Status ebenfalls eine Rolle spielt. Während Selbstständige und Beamte nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind unter den Nichtwähler knapp 10 Prozent Arbeiter, 17 Prozent Rentner und 19 Prozent qualifizierte Angestellte zu finden.
Dabei sind Nichtwähler häufiger weiblich. Vor allem junge Frauen bleiben der Urne fern.
Im Zeichen der Vier
Die Gruppe der Nichtwähler kann man grob in vier Gruppen aufteilen:
- der technische,
- der grundsätzliche,
- der konjunkturelle und
- der bekennende Nichtwähler
Zu dem technischen Nichtwähler zählen die Verhinderten (z.B. durch Krankheit), die kürzlich Umgezogenen und die in Wahllisten falsch geführten werden.
Grundsätzliche Nichtwähler sind Überzeugungstäter. Hierzu gehören Bürger, die eine große Distanz zum politischen System haben. Häufig kommen diese aus sozialen Randgruppen oder haben einen niedrigen Bildungshintergrund. Zu ihnen zählen häufig auch religiöse Gruppen wie zum Beispiel die Zeugen Jehowas.
Die dritte Gruppe ist der Politik am liebsten, denn sie kann man noch überzeugen – jedenfalls theoretisch. Sie entscheiden sich im Laufe des Wahlkampfs, ob ihre Themen oder eine ihnen sympathische Person dabei ist. Für sie ist es wichtig, dass die Wahl von Bedeutung ist, denn Wählen ist ein Staatsbürgerakt. Dabei sind diese Nichtwähler zwar „Deutsche“ aber keine „Europäer“, sprich, sie gehen am ehesten zur Bundestagswahl, meiden aber die Europawahlen. Konjunkturelle Nichtwähler wird diese Gruppe genannt, bei denen ein deutscher Obama gute Chancen hätte, denn sie lassen sich auch durch „besondere politische Ereignisse“ mobilisieren.
Was bleibt sind die bekennenden Nichtwähler. Für sie ist nicht Wählen gehen ein Mittel des Protestes. Häufig sind sie politisch interessiert aber unzufrieden mit ihrer bevorzugten Partei.
Das sind immerhin bis zu 40 Prozent der Nichtwähler, die diese Gruppe ausmachen.
Unzufriedenheit und Zufriedenheit
Neben der konkreten Unzufriedenheit mit einer bestimmten Partei gibt es aber auch eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem politischen System allgemein – mit „den“ Politikern und „den“ Parteien.
In seiner Untersuchung [gemeint ist Michael Eilfort, Anm. d. R.] sagten 32 Prozent der Wähler, alle Politiker seien korrupt. Bei den Nichtwählern vertraten über 50 Prozent diese Meinung. Zu der Formulierung „Politiker machen doch, was sie wollen“ sagten 52 Prozent der Wähler ja, aber 70 Prozent der Nichtwähler.
Denen gegenüber steht die Gruppe der zufriedenen Nichtwähler, also solchen, die „mit dem System im Allgemeinen“ zufrieden sind.
Hierbei handelt es sich um gut situierte, politisch interessiert und informierte Nichtwähler. Sie sind zufrieden mit dem politischen System und sie zeigen in der Regel eine nachlassende Bindung zu politischen Parteien, denn sie sehen wenige Unterschiede im Programm und Kandidaten der Parteien. Sie wägen Kosten und Nutzen der Wahl ab und bleiben auch gerne mal im Grünen.
Normalität oder Krise?
In der Beurteilung der schwindenden Wählerschaft stehen sich zwei Positionen gegenüber, die eine Position wird als „Normalisierungsthese“ bezeichnet, die Gegenposition als „Krisenthese“.
Die „Normalisierungsthese“ besagt, „dass inzwischen auch die Deutschen ihre “Untertanenmentalität” der fünfziger Jahre abgebaut haben“, „dass der Wähler nicht mehr das Gefühl habe, bei jeder Wahl gebraucht zu werden“. Es treten normale demokratische Verhältnisse ein, wie sie in anderen Ländern auch vorzufinden sind.
Dem gegenüber steht die These der Krise des politischen Systems, die so weit geht, dass „eine zunehmende Delegitimierung der Parteien bzw. des gesamten politischen Systems“ gesehen wird. Die Stimmenthaltung der Bürger sei ein Warnsignal. „Die Nichtwahl ist so verstanden ein bewusst eingesetztes Mittel, um Unzufriedenheit und Protest zu äußern – der viel beschworene „Denkzettel“ und damit ein Akt politischen Verhaltens.“
Was heißt das jetzt für uns?
Wenn man sich das Ganze so anschaut, dann scheint der Nichtwähler ein ziemlich bekannter Typus zu sein, vielleicht sogar bekannter als der Wähler.
Aber was heißt das jetzt für uns? Steckt Deutschland in der Krise? Müssen wir die Delegitimierung der Parteien fürchten? Oder müssen wir befürchten, dass durch die geringer werdende Wahlbeteiligung mehr antidemokratische Gruppen in die Parlamente gelangen?
Vielleicht ist es aber auch gar kein Problem, denn schließlich sind wir freie mündige Bürger und Nichtwählen ist ebenso ein Grundrecht. So wie man nicht nicht-kommunizieren kann, ist Nichtwählen auch eine Wahl.
Was meint ihr?
Mehr zum Thema:
Hintergrund